Handlungsempfehlung
Tragfähige Netzwerke für komplex traumatisierte Familiensysteme – Schutzprozesse partizipativ und interdisziplinär gestalten
Von Beate Krauth und Melanie Abbas
Unsere neue Handlungsempfehlung zeigt Fachkräften, wie nachhaltige Schutzprozesse in Familien etabliert und interdisziplinäre Zusammenarbeit gestärkt werden können.
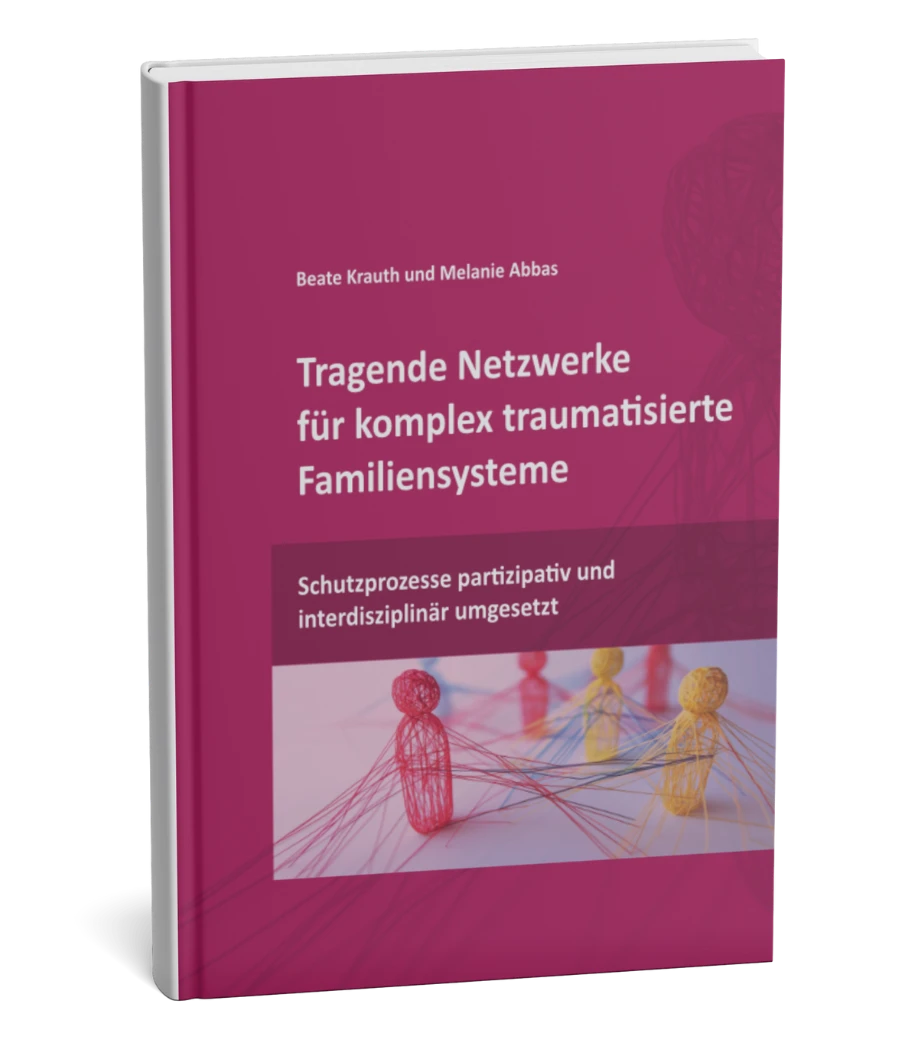

Diese Handlungsempfehlung wurde gemeinsam mit betroffenen Familien und Fachkräften des Hilfesystems erarbeitet. Unser zentrales Anliegen ist es, die transgenerationale Weitergabe sexualisierter Traumatisierung innerhalb von Familiensystemen zu durchbrechen und Wege der nachhaltigen Unterstützung für betroffene Familien zu entwickeln.
Herausforderung: Schweigen als zentraler Risikofaktor
Die Analyse von Interviews mit Betroffenen und Fachkräften aus verschiedenen Arbeitskontexten zeigt, dass das Tabuisieren und Verschweigen von sexualisierter Gewalt eine der größten Belastungen darstellen. Dieses Schweigen trägt maßgeblich zur Aufrechterhaltung und Weitergabe von Missbrauchsstrukturen bei. Innerhalb der betroffenen Familien werden Erfahrungen sexualisierter Gewalt häufig bagatellisiert, nicht thematisiert oder die Verantwortung der Erwachsenen verleugnet.
Unsere langjährige Arbeit mit Betroffenen bestätigt: Die Enttabuisierung und das aktive Durchbrechen des Schweigens sind essenzielle Voraussetzungen, um die Wiederholung traumatischer Erfahrungen über Generationen hinweg zu verhindern. Andernfalls besteht die Gefahr, dass sich dysfunktionale Muster durch Geheimhaltungsgebote und Sprechverbote in den Familien weiter verfestigen.
Strukturelle Herausforderungen im Hilfesystem
Viele betroffene Familien stehen bereits seit langer Zeit in Kontakt mit Fachkräften aus der Kinder- und Jugendhilfe, dem Jugendamt oder therapeutischen Angeboten. Trotz dieser Einbindung erleben wir eine strukturelle Fragmentierung der Hilfesysteme:
-
Unterschiedliche Träger, Institutionen und Professionen arbeiten isoliert voneinander.
-
Durch spezialisierte Zuständigkeiten kommt es zu Abgrenzungen, die eine ganzheitliche Unterstützung erschweren.
-
Ein Spannungsfeld zwischen Kindeswohl und Elternrechten führt zu Unsicherheiten in der fachlichen Praxis.
In der Folge treffen gespaltene Unterstützungs- und Therapieangebote auf gespaltene, hochbelastete Familiensysteme. Dies verhindert eine nachhaltige und wirksame Begleitung.
Schutzprozesse als systemische Antwort
Um diesen Herausforderungen zu begegnen, haben wir – auf Basis von Interviews mit Betroffenen und Fachkräften aus verschiedenen Arbeitskontexten, Erkenntnissen aus der Fachliteratur und Erfahrungen aus der Praxis – Bausteine für innerfamiliäre Schutzprozesse entwickelt. Ziel ist es, die Prinzipien der UN-Kinderrechtskonvention (Förderung, Schutz, Beteiligung) konsequent in die Arbeit mit betroffenen Familien zu integrieren.
Während Schutzkonzepte in pädagogischen Institutionen zunehmend etabliert werden, gibt es bislang kaum systematische Ansätze für den familiären Kontext. Diese Handlungsempfehlung bietet daher praxisnahe Impulse, um Schutzkonzepte auch in Familiensystemen nachhaltig zu verankern.
Ein Blick auf die Entwicklung von Schutzkonzepten in Institutionen zeigt, dass es sich um einen kontinuierlichen Prozess handelt. Obwohl seit den Empfehlungen des „Runden Tisches Sexueller Kindesmissbrauch“ (2011) wesentliche Fortschritte erzielt wurden, fehlen vielerorts noch umfassende Schutzkonzepte (Deutsches Jugendinstitut). Wenn Schutzprozesse in Familien wirksam etabliert werden sollen, müssen langfristige Strategien entwickelt und nachhaltig umgesetzt werden.
Diese Handlungsempfehlung soll Fachkräften eine praxisorientierte Grundlage bieten, um mit betroffenen Familien tragfähige Schutzstrukturen zu erarbeiten und so langfristig zur Prävention transgenerationaler Traumatisierung beizutragen.
Bald verfügbar!
Die Handlungsempfehlung gibt es hier bald zum Download – die Druckversion ist in Kürze bei Violetta e.V. erhältlich.

